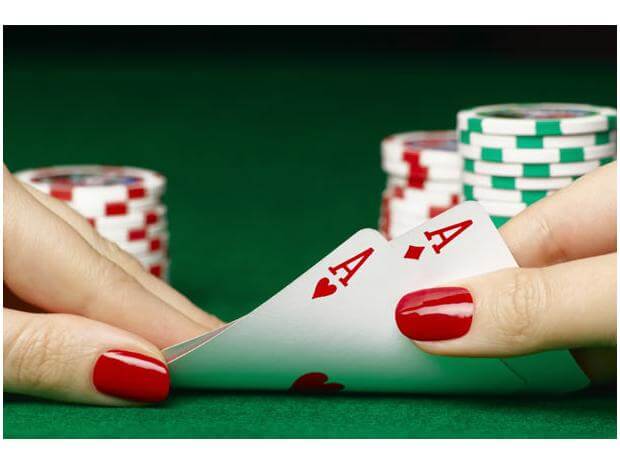Das Poker- und Casinospielen wird von vielen vor allem als Spiel für Männer gesehen. Ein Ansicht, die von den erfolgreichen Damen am grünen Tisch sicherlich nicht geteilt wird. Mit Charme, Witz und Intelligenz haben sie sich einen festen Platz in der Welt des professionellen Pokers erkämpft. Dabei wurde ihr Talent und Siegeswille von dem ein oder anderen Mann in der Vergangenheit sicherlich schon einmal unterschätzt. Ein fataler Fehler, der unter Umständen mit vielen großen Chips bezahlt wurde.
Denn Frauen haben im Schnitt nicht nur stärkere Emotionen als ihre männlichen Gegenspieler, sie besitzen häufig auch eine bessere Menschenkenntnis. Während erstere beim Poker natürlich eher hinderlich sein können, kann das richtige Einschätzen des Gegenübers zum Sieg verhelfen. Damit können entsprechend talentierte Damen Nervosität oder Siegesgewissheit oft besser detektieren und das Blatt nach Hause bringen oder rechtzeitig aussteigen. Gerade die letztere Fähigkeit macht viele Frauen zu gefährlichen Gegnern, die sich nicht so schnell ausschalten lassen.
Was macht für Frauen den Reiz am Poker aus?
Natürlich hat der Poker nämlich auch für Frauen seinen Reiz: Geht es doch nicht nur um Glück, sondern auch um die Fähigkeit, blitzschnell die richtigen Entscheidungen zu treffen und die Lage trotz der Täuschungsmanöver der Kontrahenten richtig einzuschätzen. Wer dafür ein Talent hat oder es sich von erfahrenen Pokerspielern beibringen lässt, kann am Pokertisch Erfolg haben. Mit Talent und harter Arbeit kommen so dann vielleicht schnell größere Geldbeträge zusammen.
Letztendlich kann aber nur darüber spekuliert werden, was die erfolgreichsten Pokerspielerinnen der Welt so erfolgreich macht. Denn sie legen sicherlich keinen großen Wert darauf, ihr Geheimnis jedem auf die Nase zu binden. Ein millionschweres Geheimnis will nun einmal gut behütet sein.
Einige Frauen im Poker und ihre Erfolge
Vanessa Selbst
Vanessa Selbst wird von vielen als beste Pokerspielerin der Welt angesehen, wenn es um den gewonnenen Gesamtbetrag geht. Und sie hat die Zahlen, um dies zu belegen. So hat sie mittlerweile öffentlich etwa 11 Millionen Dollar erspielt. Einen Betrag, den man ihr vielleicht nicht unbedingt zutrauen würde, wenn man sie ohne Hintergrundkenntnisse auf der Straße trifft. Auch sonst ist ihr Lebenslauf alles andere als gewöhnlich: Nach dem Elite-Studium am MIT in Californien hat sie mit ihrer Freundin den Hafen der Ehe angesteuert.
Liv Boeree
Olivia Boeree aus Großbritannien weiß ebenfalls mit den Karten umzugehen. Ein ansehnlicher Zudienst für ihre Karriere als Model. Da ist Gift für das Vorurteil, dass Menschen Model werden, weil sie sonst nichts können. Einträglich war es hingegen für Olivia Boeree, wenn ihre männlichen Amateur-Kontrahenten annahmen, dass die Sache wohl schnell vorbei sein wird. Sie ahnten noch nicht, wie sehr sie Recht behalten sollten. Überhaupt findet man erfolgreiche Spieler auch anderswo: Auch der Schachweltmeister Magnus Carlsen hat sich bereits als männliches Model ein gutes Zubrot zum Denksport verdient.
Allyn Shulman
Allyn Shulman zeigt dagegen, dass Poker durchaus nicht nur Frauen-, sondern auch schon einmal Familiensache sein kann. So hat die Dame u.a. auch schon erfolreich mit ihrem Mann an großen Pokerturnieren in den Staaten teilgenommen. Ob sie wohl mit ihrem juristischen Beruf wohl auch so schnell so viel Geld verdient hätte? Auch wenn dort bekanntlich hohe Stundenlöhne üblich sind, darf dies wohl bezweifelt werden. Die von ihr insgesamt erspielte Summe wird auf einen siebenstelligen Dollar-Betrag geschätzt. Wohl auch für den einen oder anderen Mann kein schlechtes Resultat. Der juristische Beruf bringt eben eine gewisse Menschenkenntnis mit sich. Wer sie als harmloses Großmütterchen am Pokertisch ansieht, ist seine Chips schneller los, als er ihnen „Bye-Bye“ sagen kann.
Fazit: Frauen sind den Männern im Poker mindestens dicht auf den Fersen. Wer sie in einer Macho-Laune unterschätzt, bezahlt es unter Umständen teuer. Es bleibt abzuwarten, welche Überraschungen die weibliche Pokerwelt in der Zukunft noch für uns bereithalten wird.
Beginnen Sie mit wetten mit Bet365. Sie können auch Energy casino Gutscheincode auf dieser Seite finden.
Mehr Informationen finden Sie auf Pokerspieler auf dieser Seite!